
CARLA KALKBRENNER

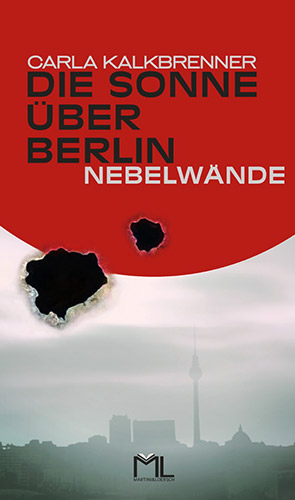
Kriminalhauptkommissar Eberhard Dahlberg, mittelgroß, mittelschwer, mittelblond, genannt Hardy, stand unter der Markise des Cafés RECHT SICHER und rauchte. Der straßenlange Kasten des Kriminalgerichts gegenüber war hinter dem Regenvorhang kaum zu erkennen. Bis zu seinem Termin waren es noch zehn Minuten. Er musste zu einer Messerattacke aussagen, einer eher schrägen als wirklich brutalen, wie sie sich seit zwei Jahren häuften. Die Polizei erwog jetzt Stichschutzwesten für jeden Uniformierten, das hatte es noch nie gegeben.
Eine Limousine hielt mit Schmackes am überfluteten Rinnstein. Die Türen gingen auf und wieder zu, vielleicht beratschlagte man über den besten Weg, trockenen Fußes an einen Latte Macchiato zu kommen. Die Wagenbesatzung stieg aus, kurzer Mantel überm Anzug, schmaler Schuh, dicker Aktenkoffer, sah nach Jurastudenten oder Anwaltsgehilfen aus. Dahlberg betrachtete die rasanten Frisuren, hinten kurz, vorne lang, gewissermaßen hikuvola. Die Männer tuschelten und ließen ihre Blicke zwischen den Schuhen und der gurgelnden Turmstraße hin und her wandern. In dem Falle konnte Dahlberg Gedanken lesen, er war rechtzeitig auf Gummischuh umgestiegen. Er ertränkte die Zigarette in einem vollgelaufenen Aschenbecher und stapfte rüber zum Gericht.
Im Verhandlungsraum schilderte er den Vorfall so knapp und sachlich er angesichts der unfreiwilligen Komik konnte. Wie er an der Kreuzung Badstraße/Pankstraße auf Grün gewartet hatte, als im Rückspiegel ein Mann mit einem Messer in der Hand und einem überglücklichen Lachen im Gesicht auftauchte, gefolgt von einem anderen Mann, der nicht so glücklich aussah und wie am Spieß schrie: ‚Haltet ihn, haltet ihn.‘ Der Fußgängerstrom war schlagartig zum Stillstand gekommen, die Passanten, manche staunend, manche grinsend, bildeten eine Gasse und ließen die beiden durch. Dahlberg hatte gerade noch gesehen, dass der schreiende Verfolger einen blutigen Hintern hatte.
„Und da haben Sie zwei und zwei zusammengezählt“, sagte der Richter mit belustigt-genervtem Gesichtsausdruck und musterte die beiden Kontrahenten, das heißt den Täter und das Opfer.
„Richtig, Herr Richter“, gab Dahlberg zurück. „Dazu war ich trotz des Anblicks noch in der Lage. Der Angeklagte hatte den Geschädigten in den Hintern gestochen, einfach so, aus heiterem Himmel.“
Dann beschrieb er die Festnahme des Messermannes. Sowie die Mühe, das Opfer von der Rache mittels eines Werbeaufstellers abzuhalten.

Alexander Taub sah aus dem Fenster. Wieder ein dunkler Tag mit dicken, grauen Wolken, aus denen dicke, graue Regentropfen fielen. In seinem Spiegelbild schwammen die Lichter der Stadt, überragt von den blinkenden Signalen des Fernsehturms. Das hatte die Verantwortlichen beim BND sicher zu Witzen animiert, Alexander Taub, zwischengeparkt in einem Apartment am Alexanderplatz. Er durfte sich draußen nicht blicken lassen und zu niemandem Kontakt aufnehmen, schon gar nicht mit Dahlberg.
Vor vier Wochen hatten sie zum letzten Mal geskypt, er, immer darauf bedacht, dass nichts im Hintergrund seinen wahren Aufenthaltsort verriet, und Dahlberg stolz, die ersten Schritte seines Sprösslings vorzuführen.
Kein Kontakt, hatte Kielbaum, der ihn seit seinem Weggang aus Berlin betreute, gesagt und dabei schräg auf der Tischkante gesessen. Geheimdienstler nehmen oft die Tischkante, könnte ja sein, dass sie sofort aufspringen und umgehend die Welt retten müssen. Dabei hatte er ausgesehen, als müsste er sich überwinden, überhaupt noch mit Alexander zu sprechen. Er konnte es Kielbaum nicht verdenken, nach dem Malheur in Ägypten. Von seiner Warte aus hatte der Mann natürlich recht. Da hatten sie Alexander langfristig als gebürtigen Russen aufgebaut, ihn in das Moskauer Security-Unternehmen eingeschleust und erreicht, dass die ihn in der russischen Botschaft in Kairo einsetzten. Und dann war alles schiefgegangen. In Kielbaums Augen hatte Alexander es vermasselt.
Er lehnte den Kopf an die Scheibe und sah nach unten. Auf dem Platz waren Aufbauarbeiten im Gange. Schwere Trucks fuhren vor, Zäune, Bretter und ganze Buden wurden abgeladen, wahrscheinlich für ein Volksfest. Fast eine Woche wartete er schon auf den neuen, seinen letzten Auftrag. Warten können, die mit Abstand wichtigste Fähigkeit in der Branche. Er hatte in Kairo gewartet. Gewartet und gewartet. Und war vor Langeweile fast umgekommen, so hatte er sich den Außeneinsatz nicht vorgestellt. Als der Wirtschaftsattaché bat, ihn zu den Gasfeldern in der Katterasenke zu begleiten, hatte er zugegriffen und sich eingeredet, dass keine Zeit mehr war, Berlin zu informieren.
Alexander stieß sich vom Fensterbrett ab und landete direkt auf dem Bett. In dem winzigen Apartment war es still wie in einem Grab, nicht das leiseste Geräusch. Die Stadt da unten schien nicht zu existieren. Und auch auf dem Flur kein akustisches Lebenszeichen. Die Arme hinterm Kopf verschränkt, starrte er an die Decke. Es hätte tatsächlich schlimmer ausgehen können, viel schlimmer. Der ungedeckte Ausflug in die Wüste war unbestreitbar ein Sicherheitsrisiko gewesen. Aber was hätte er denn sagen sollen, nein danke, ist mir zu heiß und zu salzig?
Er ließ sich neben das Bett fallen und machte ein paar Liegestütze, Bewegung half gegen den Koller. Außerdem musste er wieder zu Kräften kommen. Nach zwanzig Wiederholungen war er fix und fertig. War auch kein Wunder nach wochenlangem Stillsitzen oder Stehen oder Liegen. Auf einer Strohmatte, aus der Sand rieselte, wenn er sie früh zusammenrollte, damit er tagsüber eine Sitzgelegenheit hatte. Als einzige Bewegung alle vier Stunden der Gang zur Toilette, genauer zu dem Raum, in dessen Mitte ein Loch zur Bedürfnisbefriedigung einlud. Sie wurden einzeln zu dem Hilfsabort geführt, als wenn sie gemeinsam die Flucht planen könnten. Hinaus in die Freiheit, die keine war, die aus nichts anderem bestand als Sand, Sand und nochmals Sand. Und Salz. Er und der Attaché, gekidnappt in der Kattarasenke, festgehalten, um Lösegeld zu erpressen. Durch das löchrige Strohdach der Lehmhütte hatte am Tage die Sonne herein gezischt und nachts kaltes, schwarzes Nichts geblickt. Seine Kräfte waren so schnell geschwunden wie die Barthaare gewachsen.
Alexander zog das durchgeschwitzte T-Shirt und die Turnhose aus, ging ins Bad und duschte. Er trocknete sich umständlich ab und setzte sich nackt aufs Bett. Dann wälzte er sich Richtung Fenster, stand auf und sah wieder hinaus. Auf dem Alex war Ruhe eingekehrt, die Trucks waren verschwunden, die Gitterstapel in einen Zaun verwandelt. Die Bretterbuden hockten dicht gedrängt wie finstere Tiere zwischen den blau leuchtenden U-Bahn-Eingängen. Eine Regenschirmarmee bewegte sich wie ferngesteuert um das abgesperrte Festareal herum. Jedenfalls konnte er demnächst aussteigen, natürlich unter strengsten Geheimhaltungsauflagen. Auch wenn Kielbaum zuvor gemosert hatte, dass der Dienst kein Zug sei, den man nach Belieben verlässt, wenn man einmal zugestiegen war.

Der Tagesrapport war zu Ende, die Runde aufgelöst. Karl Wertstein, Chef der Abteilung Organisierte Kriminalität beim Berliner Landeskriminalamt, war auf einen Wink hin sitzen geblieben. Der Oberste, wie der Leiter des LKA Delikte am Menschen allgemein genannt wurde, stand am Fenster und zögerte. Er musste die Sache geschickt einfädeln, wenn es um Dahlberg, seinen Wahlsohn ging, war Karl empfindlich. Und es ging um Dahlberg, beziehungsweise um einen endgültigen Nachfolger für Alexander Taub, seinen früheren Partner. Der hatte vor drei Jahren gekündigt und ward seitdem nicht mehr gesehen. Und nichts deutete darauf hin, dass sich das ändern würde. Immer wieder war er Dahlbergs Wunsch nachgekommen und hatte die feste Stelle nicht besetzt, sondern dem Team Springer zugeordnet. Das ging nicht so weiter.
Karl wartete. Er hatte die pfannengroßen Hände vor dem Bauch verschränkt und den mächtigen Schädel schräg gelegt. In seinem Bulldoggengesicht stand die Frage: Kommt hier noch was?
Erst mal rantasten, dachte der Oberste und wandte sich um. „Wie geht’s eigentlich Dahlberg in der neuen Rolle? Kommt er klar als Vater? Braucht man Nerven in dem Alter.“
„Wie schon“, brummte Karl. „Mal so, mal so.“ „Und du? Bist du stolz, dass er den Nachwuchs nach dir genannt hat?“
„Das fragst du jetzt? Der Junge ist anderthalb! Was willst du?“ Mit einem Seufzer ließ der Oberste sich in den Schreibtischstuhl fallen.
„Also gut. Du weißt doch, dass Mahlmann den Gesamtpersonalrat verlässt?“
Wertstein antwortete nicht, schon gar nicht auf rhetorische Fragen. Er brummte nur etwas Unverständliches. Der Oberste nahm erneut Anlauf. „Mahlmann kommt also zurück, seine alte Stelle in der Mord Vier ist aber längst besetzt und ich habe immer noch die freie in Dahlbergs Team.“ Karl kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn. „Und? Weiter?“ Sein gutmütiges Hundegesicht wurde ein wenig hart.
„Nichts weiter“, sagte der Oberste. Es klang sicher so erschöpft, wie er sich fühlte. Und hoffentlich zugleich nach einer ausgemachten Sache. Er fuhr sich durch die Haare und schlug auf den Aktendeckel, der vor ihm lag.
„Was würdest du denn machen?“
„Tu nicht so“, sagte Karl und stemmte seine Masse mühsam aus dem Sessel. „Ich soll dir doch nur den Segen für etwas geben, das du schon längst entschieden hast.“
Der Oberste sah zu dem Berg auf, der auf ihn herabsah. Sie kannten sich schon eine Ewigkeit. Aber nahe gekommen waren sie sich erst bei der Trauerfeier für Tara, Karls halbindischer Frau. Sie war vor zwei Jahren gestorben. Wortlos waren sie über den Friedhof gegangen, wortlos hatten sie an Taras Grab gestanden, wortlos hatten sie beim Leichenschmaus, den seine Kinder trotz Karls Widerstand ausgerichtet hatten, nebeneinander gesessen. Seitdem gab es ein Band zwischen ihnen. Irgendwann hatte er dann auf eine Frage geantwortet. Auf die Frage, wie es ihm geht, hatte er gesagt: ‚Und dir?‘ So war ihre Freundschaft entstanden, die mit wenigen Worten auskam. Auch bei Streitfragen.
„Horst“, kam es tief aus Karls Mund. „Tu, was du tun musst.“
„Lass das.“ Der Oberste mochte es nicht, wenn jemand seinen Vornamen benutzte, aber um so etwas scherte Karl sich natürlich nicht. „Ich sag dir, Kollege Mahlmann ist bei der Dahlbergtruppe bestens aufgehoben. Die werden ihn schon ordentlich rannehmen, ehrlich.“
„Ehrlich?“ In Karls gefälteltes Gesicht schlich sich ein ironischer Ausdruck. „Nicht Rache für Dahlbergs Starrsinn?“
Der Oberste wackelte halb bestätigend, halb verneinend mit dem Kopf. Karl schob sich schnaufend durch die Tür.

Gabriel Troost saß seitlich auf dem Esstisch, ein Bein auf das Parkett aus Raucheiche gestemmt, das andere schwang nervös auf und nieder. In zwei Stunden begann das Meeting. Die Entwickler hatten ihre Arbeit getan, jetzt waren die Grafikdesigner dran. Jeder von ihnen wollte den Auftrag für seine Agentur an Land ziehen, die würden bei dem Wettrennen alles aus sich rausholen. Wenn denn was drin war.
Die Espressomaschine röhrte, dann das Gurgeln und Fauchen der Milchschaumdüse. Die Haushälterin, Frau Häberle, reichte ihm die Tasse. Ihr Mann war vor einem Jahr gestorben und sie war dem Ehepaar Troost in die Hauptstadt gefolgt.
„Und, haben Sie sich schon etwas eingelebt in Berlin?“, fragte Troost und lächelte ihr aufmunternd zu, er wusste um die einnehmende Kraft seines Lächelns.
„Es geht so, Herr Troost, wenn es bloß sauberer wäre.“ Frau Häberle verzog das Gesicht.
„Da haben Sie recht, Frau Häberle, da haben Sie recht.“ Er ließ sein Lächeln noch breiter und herzlicher werden.
„Oh, Mister Big beim vertrauensbildenden Angestelltengespräch“, kam es von der Wendeltreppe. „Was für ein Anblick.“ Vanessa war noch im Morgenmantel, aber schon biestiger Stimmung, das Pendel war heute also in Richtung Provokation ausgeschlagen. „Musst du nicht weg, euer neues Superprodukt auf den rechten marketingtechnischen Weg bringen?“ Frau Häberle schlug die Augen nieder. Gabriel Troost nippte an seinem Kaffee, er zwang sich zur Ruhe. Wie immer, wenn seine Frau darauf aus war, ihn zu reizen.
„Und du denkst daran, dass wir für heute Abend eine Einladung ins SEEHAUS haben?“
„Wie könnte ich das vergessen“, gab Vanessa zurück und stieg die Treppe wieder hinauf. Gabriel Troost schluckte einen Kommentar herunter, hoffentlich hatte sie sich bis zum Abend wieder eingekriegt. Wenn nicht, würde sie schon sehen, was sie davon hatte. Er griff Mantel und Autoschlüssel, fuhr in die Tiefgarage und bestieg den Wagen.
Es regnete in Strömen, aber wenigstens ging es zügig stadtauswärts. Stadteinwärts staute sich wie jeden Morgen der Verkehr. Er kam langsam wieder runter, er konnte sich jetzt nicht mit Vanessas Launen beschäftigen, er musste die neue Anti-Cellulite-Creme auf den Markt bringen, und das rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft. Hinter der Kleingartensparte bog er Richtung Spree ab, das Firmengelände grenzte direkt ans Ufer. Trotz des Regendunstes waren die Begrenzungslichter des Backsteinturmes zu sehen, aus der Führungsetage im zehnten Stock fiel schwaches Licht.
Als Troost den Konferenzraum betrat, kamen die Werbeleute blitzartig aus ihrer lässigen Haltung, mit der sie in den Stühlen gehangen und gelangweilt ihre Tätowierungen studiert hatten.
Von der Forschungsabteilung war nur Gerald Winkler als Chefentwickler dabei, einen siegessicheren Ausdruck im Gesicht. Troost nahm Platz, drehte sich mit dem Sessel zu den Aufstellern und betrachtete die Verpackungsentwürfe. Hinter ihm breitete sich angespannte Stille aus. Das war nichts, dachte er, das war kalt, computergeneriert, ohne Seele. Und zugleich viel zu marktschreierisch. Er wandte sich um und ließ fein gezügelte Wut sehen.
„Kennen Sie das erste Gebot eines Malers?“ Die Kreativen wirkten, als wären ihnen Eisbrocken vor die Füße gefallen. Sie schienen zu schrumpfen, Ratlosigkeit und zugleich das Bemühen um Coolness in den Augen.
„Du sollst den Kitsch riskieren.“ Seine Gegenüber blickten ungläubig. „Riskieren, nicht machen“, fuhr er fort, setzte wieder sein einnehmendes Gesicht auf und sah die Herren freundlich an, Schock und Zuwendung, immer schön im Wechsel. „Fahren Sie Ihre Antennen aus, nehmen Sie Schwingungen auf, fangen Sie den Zeitgeist ein. Was ich erwarte: Ein emotionales Hohelied ohne die üblichen Übertreibungen.“
Winkler sah ihn scheinheilig an. „Also die Quadratur des Kreises.“
Troost unterdrückte das Verlangen, die Krawatte zu lockern, bloß keine Reaktion zeigen. Denn Winkler hielt das Patent auf den Hauptwirkstoff, die Firma hatte nur den Produktschutz auf JUNGBRUNNEN.
„Oder das Einfache, das so schwer zu machen ist, lieber Doktor Winkler.“
Der Chefentwickler machte unbeeindruckt weiter.
„Die Formel ist revolutionär. Und dann das Wort Revolution vermeiden – eine echte Herausforderung.
“Halt bloß die Fresse, verdammte Laborratte, dachte Troost, hast doch auch nur deine Unterratten schuften lassen und dann den Entdeckerruhm eingestrichen. Gabriel Troost, wusste, dass er ungerecht war, der Mann war ein begnadeter Entwickler. Und dass er mit dem Menschen überkreuz war, dass der Typ sich innerlich über ihn totlachen musste, dass der Oberchemiker die Oberhand hatte, das alles musste er im Moment beiseite schieben.
„Sie haben ja so recht, Herr Kollege, eine echte Herausforderung für unsere Kreativen. Und Sie dürfen sich jetzt wieder Ihrer verdienstvollen Forschungsarbeit zuwenden.“ Winkler verschwand, nicht ohne ihm einen hämischen Blick zuzuwerfen.

Vanessa Troost betrachtete ihren Mann von der Seite, starker Nacken, ausgeprägtes Kinn, hohe Stirn. Eindeutig gutaussehend, beeindruckend sowieso. Stattlich, so nannte er es, auch heute wieder, als sie sich für die Abendeinladung fertig machten und Gabriel sich vor dem Spiegel drehte und wendete. Mit unübersehbarer Neigung zur Korpulenz, ergänzte sie dann im Stillen. Sie kannte seinen Kampf und seine Eitelkeit. Gerade hatte er die Keine-Kohlenhydrate-Phase. Früh Rührei, mittags Fisch, abends Fleisch, zubereitet von Frau Häberle, ihrer Haushälterin.
Das Dinner im SEEHAUS hatte ihn beflügelt. Wie immer, wenn er ausreichend Publikum gehabt hatte, das er beeindrucken, erschrecken, bezaubern und an die Wand quatschen konnte. Und kaum jemand ahnte, dass es vor allem um die Rettung vor dem Gewäsch der anderen ging, also dem, was Gabriel für Gewäsch hielt.
Vanessa sah aus dem Seitenfenster, auf der Potsdamer Straße trotzten zwei dienstbare Damen der Witterung. Die hautengen Leggings glänzten hell, ihre Gesichter waren durch Regenschirme verdeckt. Vanessa schlug die Beine übereinander, der Stoff raschelte. Gabriel legte seine rechte Hand auf ihr linkes Knie, das aus dem Schlitz im Kleid ragte. Sie ließ es geschehen. Umso tiefer würde nachher der Fall sein. Denn sie hatte fast den ganzen Abend nur Gabriels Rücken gesehen. Nach dem Essen hatte er quer über den Tisch hinweg die ersten Opfer ausgemacht, ein älteres Paar, das seit Jahrzehnten eine Fabrik für Emailwaren am Leben erhielt. Und sie war abgemeldet, was natürlich jeder mitbekam. Beate, die Frau des Firmenerben, diese Trutsche mit Perlenbehang, hatte ihr mild-verlogen zugelächelt. Und Manfred sich bemüht, seinen gierigen Blick in Vanessas Ausschnitt zu verbergen. Zugleich hatte er gelangweilt getan, die Überlegenheit seines Geschäftsführers war für den Firmeninhaber schwer zu verkraften. Denn die Tischgesellschaft hatte hingegeben Gabriels Vortrag über die neuesten Erkenntnisse der Werbepsychologie gelauscht, Anmutung, emotionaler Gewinn, innere Bilder. Das innere Bild eines Emaillekochtopfs, eigentlich war es zum Brüllen.

Vanessa nahm die Beine auseinander, Gabriels Hand wanderte höher. Sie legte ihren linken Arm um seine Schultern und strich ihm über den Nacken. Die erotische Spannung war gewissermaßen mit Händen zu greifen.
Später am Abend war das Thema gewaltfreie Kommunikation aufs Tapet gekommen, unverzichtbar in der heutigen Unternehmensführung. Diesmal ausgeführt oder vielmehr vorgeführt am Beispiel einer alteingesessenen Westberliner Werbefirma, die gerade am Abkacken war. Die beiden Chefs, ein schwules Paar um die sechzig in abgestimmten Outfits, befanden sich nullkommanichts in der Rolle von Zuhörern, die subtile Ohrfeigen einzustecken hatten. Und sie fanden es toll, sie waren begeistert, obwohl die Kommunikation keineswegs gewaltfrei und äußerst einseitig gewesen war. Und Vanessa hatte den versteckt-verschämten Ausdruck in den Augen der beiden gesehen, dieses Unwohlsein während des Wortgewitters, das die Begeisterung und das Entzücken begleitete. Das war so, seit sie Gabriel kannte. Und seit er die Firma auf Vordermann gebracht hatte, seit er die besten Fachleute angeworben, die erfolgreichsten Werbekampagnen auf den Weg gebracht und die Familie Arnheim einen Rekordgewinn nach dem anderen eingefahren hatte, war sein Selbstbewusstsein nicht mehr zu toppen. Als sie Gabriel im Leipziger Hochschullabor kennenlernte, war sie sofort fasziniert von seinem Auftreten, der Redegewandtheit, der funkelnden Intelligenz. Und seinem Charme. Bei ihrem ersten richtigen Date hatte er drei Stunden am Stück geredet, über seine Diplomarbeit, über die Wende und die Chancen, die sie bot und die man ergreifen müsse. Zwischendurch hatte er feine, kleine Komplimente eingeflochten, sie war Gabriel bald ganz verfallen.
Die Neue Nationalgalerie mit ihrem riesigen dunklen Dach zog vorüber, dann das Goldgezacke der Philharmonie. Über dem Potsdamer Platz thronte der Fujiyama von Berlin in geisterhaftem Licht, das Dach des Sony-Centers. Vor dem Haus im Prenzlauer Berg angekommen, ratterte das Gittertor der Tiefgarage in die Höhe, der Wagen fuhr auf den Parkplatz. Der Lift führte direkt in das Loft.
„Willst du vorher noch einen schönen Schluck?“, fragte Gabriel beim Verlassen des Fahrstuhls. Vanessa nickte und ging ins Ankleidezimmer. Er würde jetzt eine Flasche Whisky nach der anderen aus der Bar nehmen, sie gegen das Licht halten, sie öffnen und daran riechen, die Etiketten lesen und dann die Wahl treffen, welche Sorte jetzt die richtige sei, sie hatte also eine halbe Stunde Zeit. Taghell flammten die Strahler auf und beleuchteten mehrere Regalmeter Klamotten, links ihre, rechts seine, dazwischen verschiebbare Spiegel. Sie ließ sich auf die Polsterbank in der Mitte fallen, streifte mit heftigen Fußbewegungen die High Heels ab und betrachtete ihre mageren Füße und die knochigen Knie, der Preis für Modelmaße. Dann gab sie sich einen Ruck, stand auf und öffnete den Reißverschluss, das Seidenkleid fiel raschelnd zu Boden. Aus dem Kaminzimmer war das Klingeln von Eis zu hören, die Entscheidung war also gefallen. Ihre auch. Sie zog eine der Wäscheschubladen auf und nahm den schwarzen elastischen Anzug heraus, eigentlich ein medizinisches Kleidungsstück, mit dem die Wirkung der neuen Körpercreme verstärkt werden sollte. Seltsam, dass das heute nicht das Hauptthema gewesen war. Das Mittel sollte doch der Durchbruch auf dem weltweiten Anti-Cellulite-Markt sein, Gabriels und Manfreds neuester Coup.
Vanessa Troost streifte den straffen Anzug über, der Brüste und Schritt freiließ, das Zuhaken dauerte. Gabriel würde sich noch wundern, wozu sie in der Lage war, dachte sie, das Fürchten würde sie ihn lehren. Sie schlüpfte wieder in die hohen Pumps, warf einen Blick auf ihr bizarres Spiegelbild und stolzierte in Richtung des Eiswürfelklirrens.
Gabriel saß vor seinem Whisky, lässige Haltung, wachsamer Blick, beherrschter, kontrollierter Gesichtsausdruck. Kontrolle und Selbstbeherrschung waren für ihn das Wichtigste. Auch bei den Shows, die er für die Öffentlichkeit abzog. Dabei würde er es nie aussprechen. Sätze wie ‚Alles unter Kontrolle‘ überließ er Wichtigtuern und anderen Wichten.
Vanessa durchmaß in aufreizendem Wiegeschritt die Wohnlandschaft und drehte sich kunstvoll um die eigene Achse.
Gabriels Augen weiteten sich unmerklich. Sie spürte seine Anziehungskraft und ihr Verlangen. Aber trotzdem. Sie warf ihm eine Kusshand zu, ging schnell zur Garderobe, nahm den erstbesten Mantel, schnappte die Autoschlüssel, öffnete die Tür und schloss sie betont leise.

Kielbaum hatte vor einer halben Stunde angerufen, er werde abgeholt, in genau einer halben Stunde. Auf die Minute glitt ein Wagen mit getönten Scheiben durch das feuchte Laub im Rinnstein und hielt. Alexander verließ die Deckung des Eingangs, huschte über den Bürgersteig und stieg ein. Nach einer halben Stunde waren sie in der Chausseestraße, früher Grenzrandniemandsland, jetzt eine einzige Baustelle. Ein gewaltiger Gebäudekomplex tauchte auf. Donnerwetter, das war sie also, die neue BND-Zentrale. Riesenarme, die in die Stadt hineinragten. Datenkrake, dachte Alexander und sah zu den Fenstern in einem endlosen Raster hoch. Raster, Raster, Rasterfahndung, mit so einer Assoziation hatten die Baumeister bestimmt nicht gerechnet.
In einem kleinen Raum mit zwei schmalen Fenstern warteten zwei Herren in Schlips und Kragen. Kielbaum, sein Betreuer mit der Bodybuilderfigur und der winzigen Goldrandbrille, stellte den anderen Mann vor. Er hieß Meier und war auch so unscheinbar. Die beiden standen jeder vor einem der Rasterfenster, im Gegenlicht waren ihre Gesichter schattig, Meier schien eine Palme aus dem Kopf zu ragen. Alexanders Gesichtsausdruck musste Bände gesprochen haben, denn Kielbaum trat beiseite.
„Darf ich vorstellen: Die Palme, Stahl, zehn Stockwerke hoch, grüner Tarnanstrich. Wir wissen auch nicht, was der Künstler damit ausdrücken will.“
Alexander trat ans Fenster, das war der Wahnsinn, zwei Riesenpalmen im Hinterhof des Geheimdienstes, vielleicht als Trost bei Fernweh gedacht. Er drehte sich um, er hatte keine Sehnsucht nach Palmenland.
„Also, worum geht’s?“
Die beiden sahen einander an, als wenn sie sich überwinden müssten. Hört schon auf mit dem Getue, dachte Alexander. „Wir wären nicht noch einmal an Sie herangetreten“, begann Meier, „wenn es nicht wirklich wichtig wäre.“
„Wir müssen auf Sie zurückgreifen, vielmehr auf Ihre speziellen Fähigkeiten“, ergänzte Kielbaum scheinheilig.
„Wir haben damals ja auch ordentlich in Sie investiert.
“ Nicht so viel wie ich, du Pfeifenheini, trichter du dir mal so schnell eine fremde Sprache ein. Aber Kielbaum hatte ihn von Anfang an nicht gemocht. Dass er plötzlich unverzichtbar sein sollte, musste ihm mächtig gegen den Strich gehen. Meier warf seinem Mitstreiter einen tadelnden Blick zu. Offensichtlich hielt er dessen Ton für kontraproduktiv.
„Wie dem auch sei“, übernahm er die Gesprächsführung, „Sie müssen sich auf einige Risiken einstellen.“
Risiken beim Außeneinsatz, echt überraschend.
„Auf ein besonderes Risiko.“ Meier senkte die Stimme, dabei war hier alles sowas von abhörsicher. „Jemand könnte Sie wiedererkennen.“
Die beiden nahmen an ihren Schreibtischen Platz. Alexander sah sich um, es gab keine weitere Sitzgelegenheit. Er lehnte sich an die Wand zwischen den Fenstern. Meier schlug eine Mappe auf und machte eine auffordernde Handbewegung.
„Kommen Sie schon her.
“ Alexander stieß sich ab und trat an den Tisch. „Kennen Sie diesen Mann?“ Meier drehte ein Foto in Alexanders Richtung. Es zeigte einen Herren im Anzug, gepflegter Bart, Hornbrille, sanfter Blick.
„Kennen ist zu viel gesagt“ sagte Alexander. „Er war öfter in der Botschaft beim Wirtschaftsattaché. Was ist mit ihm?“
„Das.“ Meier nahm das Bild und wedelte damit. „Das ist Abu Bashir, Abteilungsleiter im ägyptischen Landwirtschaftsministerium.
“ Wieder Kairo, fragte sich Alexander, wie sollte das gehen, seine Legende war doch verbrannt.
„Soweit wir wissen“, fuhr Meier fort, „hat er von Landwirtschaft keine Ahnung. Aber er war Ende der Achtziger Mitglied der Volksmudschahedin im Irak, einer marxistisch-religiösen Organisation, die Kommunismus und Islam zusammenbringen wollte. Während des letzten Irakkrieges wurde deren militärischer Arm zerschlagen und ihm gelang 2003 die Flucht nach Ägypten.“
„Und warum interessiert sich der BND dafür?“, warf Alexander ein.
„Weil diese Leute weiter aktiv sind, auch in Deutschland. Sie wurden zwar von der EU-Terrorliste gestrichen … Aber bei einem Vermögen von insgesamt fünfhundert Millionen Euro …“
„Also wieder Kairo?“, fragte Alexander. „Nicht Kairo“, sagte Kielbaum. „Sie gehen noch einmal nach Moskau.“

Dahlberg war mit Claudia auf dem Weg nach Oberschöneweide, wo die Kosmetikfirma JUNGBRUNNEN ihren Sitz hatte. In einem Labor hatte es eine Explosion mit einem Toten gegeben, dem Leiter der Forschungsabteilung Gerald Winkler, das klang interessant.
Sein Handy klingelte, die Sekretärin des Obersten war dran.
„Der Chef will dich sehen, übermorgen um zehn“, schmetterte sie laut und heiter wie immer.
„Worum geht’s?“, fragte Dahlberg pro forma. Er ahnte, dass es wieder um einen Ersatz für Alexander ging.
„Du weißt schon“, lautete die Antwort auch prompt.
„Klar, warum frag’ ich überhaupt?“
Dahlberg drückte das Gespräch weg, Claudia atmete schicksalsergeben aus. Seit Alexanders Abgang ging das so, immer wieder wechselnde Kollegen. Weil Dahlberg den Obersten überzeugt hatte, die Stelle nicht fest zu besetzen. Alexander würde es seiner Meinung nach bei dem Moskauer Wachschutz auf Dauer nicht aushalten und bestimmt zurückkehren.
„Lange macht der Oberste das nicht mehr mit“, murmelte sie.
„Ich weiß“, sagte Dahlberg.
Rechter Hand zogen Neubauten vorbei, dahinter war die Spree zu erahnen. Eine dunkle Straßenschlucht führte mitten durch das Kraftwerk Rummelsburg. Dann zog Niemandsland vorüber, Tankstellen, Baustellen, Leerstellen, kümmerlicher Wald. Das Navi befahl, rechts abzubiegen. Sie passierten eine Tankstelle und einen Metallzaun, hinter dem aufgeworfene Erdhügel bevorstehende Bauarbeiten ankündigten. In der Ferne rumorte ein Bagger, der Greifarm führte ein abgezirkeltes Ballett auf, beim Rückwärtsfahren ertönte ein durchdringendes Piepen. Unversehens befanden sie sich in einer Kleingartenanlage, Hecken hinter Maschendraht, Schmiedeeisen oder hölzernen Staketen, Parzellen mit Obstbäumen und Dahlien. Im Schritttempo ging es durch waschwannentiefe Bodenwellen, das Sand-Kies- Gemisch knirschte in Zeitlupe. Die Fahrt endete an einem Fähranleger der Spree, sie hatten sich verfahren.
„Die Ermittlungswege sind unerforschlich“, murmelte Claudia. Dahlberg wendete, nahm auf Anweisung des Navis den nächsten Sandweg und landete wieder an der Spree, an einer Marina. Segelboote und Motorjachten lagen dicht aneinander vor Anker. Dahlberg schaltete das Navi aus, es war offensichtlich überfordert. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sie sich aus dem Wegewirrwarr herausgewunden und das Firmengelände erreicht hatten. Der Schlagbaum stand senkrecht. Der Wagen rumpelte über eine unebene Betonfläche. Sie stellten sich neben die Batterie Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr und stiegen aus. Vor ihnen ein langgestrecktes, flaches Gebäude, dunkelbrauner Backstein, getönte Scheiben. Daneben ein Hochhausturm mit Fenstern wie in einem Kloster. Beides verbunden durch einen gläsernen Gang in luftiger Höhe. Der Uniformierte, der den Eingang des Flachbaus bewachte, nickte ihnen zu.
„Zweiter Stock, dann links, immer dem Geruch nach.“

Claudia Gerlinger warf einen Blick auf das Chaos. Der gesamte Boden war von Splittern bedeckt. Hier und da stiegen Rauchfähnchen auf, da reagierte wohl noch etwas miteinander. Es roch scharf und chemisch. In der Mitte stand ein langer geschlossener Stahltisch, ebenfalls von Scherben übersät. Mittendrin Bunsenbrenner und verbogene Metallgestelle, sicher die Halterungen der zersprungenen Glaskolben. Ein leises Summen erfüllte den Raum. Es kam von zwei großen Kühlschränken, nicht von den Neonröhren, die waren ebenfalls geplatzt. Die Fensterscheiben zum Flur hin hatten gehalten, wahrscheinlich Sicherheitsglas, waren aber halb blind von Splittern. Die Displays zweier Computerbildschirme sahen aus, als hätten sie Ausschlag, es waren Einschläge. Die Computer selbst schienen intakt. Die Festplatte würde hoffentlich Auskunft über das Experiment geben, das hier schief gelaufen war. Oder was auch immer passiert war.
Die Spurensicherung war schon da. Einer staubte die Tasten des Schließsystems ab. Ein anderer kniete vor der offenen Tür und fotografierte. In seinem weißen Ganzkörperanzug ähnelte er einer Riesenmade. Er sah zu ihnen hoch.
„Ihr könnt erst rein, wenn ich alles durchfotografiert habe.“ Hinter ihnen ertönten eilige Schritte. Sie drehten sich um, der Gerichtsmediziner Friedbert Saalbach nahte mit Dienstkoffer und Fliege.
„Tach, Leute.“ Er blieb auf der Schwelle stehen und beugte sich vor. „Was ist das denn?“
„Viel Glas“, sagte Dahlberg.
„Und wie ist das passiert?“
„Wissen wir noch nicht.“
„Und wo ist der Tote?“
„Wahrscheinlich hinter dem Tisch.“ Claudia deutete auf den Fotografen, der mit seiner behandschuhten Hand vorsichtig die Scherben beiseite schob, auf Knien weiter voran rutschte und sich bis hinter den Tisch vorarbeitete. Sein Kopf tauchte auf, das Oval des Gesichts rot vor Anstrengung.
„Ihr könnt jetzt.“
Friedbert ging auf der frei geschaufelten Schneise voran. Dahlberg und Claudia folgten im Gänsemarsch. Es sah ungefähr so aus, wie sie befürchtet hatte. Inmitten unzähliger Glasscherben lag ein Mann, dessen Kittel vor einigen Stunden sicher blütenweiß gewesen, jetzt aber blutdurchtränkt war. Um Kopf und Oberkörper war eine große Blutlache dabei einzutrocknen. Das Gesicht war übersät mit Wunden. In einigen steckten Splitter. Aus dem Hals ragte eine rote Scherbe, es war mit Abstand die größte. Ausgerechnet die größte hatte ausgerechnet die Halsschlagader getroffen, dachte Claudia, das war zumindest bemerkenswert.
Der Gerichtsmediziner stellte den Koffer ab, klappte ihn auf und nahm ein Paar Gummihandschuhe heraus.
„Das kommt raus, wenn zusammenkommt, was nicht zusammengehört.“
„Friedbert“, sagte Dahlberg. „Wir wissen, dass du ein ganz Abgebrühter bist.“
Saalbach kniete sich hin.
„Verbluten aufgrund der Durchtrennung der Halsschlagader, ziemlich klare Sache.“ Der Rechtsmediziner griff nach seiner Fliege und schob sie ein Stück höher, als wenn er seinen Hals schützen wollte. Klassische Übersprungshandlung, dachte Claudia, von wegen hartgesotten.
Friedbert stand auf. „So etwas hatte ich noch nie. Die Partnerin eines Messerwerfers schon.“
Claudia sparte sich einen Kommentar und winkte einem der Vermummten. „Die Scherbe aus dem Hals muss in eine Extratüte.“
Der Chef der Spurensicherung näherte sich.
„Sieht alles nach einer chemischen Kettenreaktion aus, die in einer Explosion gemündet ist. Ob der Mann selbst einen Fehler gemacht hat oder jemand nachgeholfen hat?“ Er hob die Schultern. „Beides ist möglich. Nach der Untersuchung der Scherben und der Rückstandsanalyse wissen wir mehr.“
„Danke“, sagte Dahlberg und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. „Sagt mal, Jungs, wo ist denn sein Handy?“
„Fehlanzeige. Vielleicht hatte er keins, diese Forschertypen sind ja manchmal komisch.“ Dahlberg und Claudia folgten dem Pathologen auf den Flur. Friedbert verabschiedete sich und eilte davon. Zwei Männer mit einer Trage näherten sich.
„Können wir ihn mitnehmen?“, fragte einer der beiden. Claudia nickte. Dahlberg zog eine Packung Zigaretten hervor.
„Erstmal Luft schnappen.“
„Luft ist gut.“ Claudia deutete auf die Schachtel. Sie stiegen die Treppe zum Erdgeschoss hinunter. Vor der Tür steckte Dahlberg sich eine Zigarette an. Claudia hielt einen Meter Abstand.
„Auf den ersten Blick sieht es nach einem Unfall aus“, sagte sie und wedelte zusätzlich den Rauch von sich weg.
„Aber dich stört, dass die größte Glasscherbe direkt die Halsschlagader getroffen hat, stimmt’s?“
Sie nickte. Dann wandte sie sich zu dem Polizisten um, der stoisch vor dem Laborgebäude ausharrte.
„Die Wachleute und die Reinigungstruppe? Wo können wir die sprechen?“ „In der Kantine.“ Der Mann zeigte in Richtung Spree. „Links hinter dem Verwaltungshochhaus. Ich schicke die Laborkollegen dann auch dahin.“

Dahlberg warf die Kippe auf den Boden und trat sie aus.
Sie gingen unter der Glasbrücke hindurch Richtung Spree. Zwischen hohen Bäumen in der Nähe des Ufers tauchte ein Bauwerk wie aus einem Sience-Fiction-Film auf. Von weitem sah es aus, als hätte ein Riese mit dem Dach Karate geübt. Es war eingeknickt, ein Teil ragte steil in die Höhe, der andere nur ein bisschen. Die Wände waren von oben bis unten und rundherum verglast.
„Man gönnt sich ja sonst nichts“, murmelte Claudia, als sie den schrägen Bau betraten. Dahlberg sah zu der schiefen Decke hinauf, die aus riesigen Waben wie bei einem überdimensionalen Bienenstock bestand. Durch einige sah man den Himmel, andere waren mit hellem Holz ausgelegt, manche mit Lichtquellen bestückt. Es war trotz des trüben Tages unglaublich hell.
Die Reinigungstruppe hatte am Ende eines langen Tischs Stellung bezogen. Sie bestand aus fünf Personen in roten Overalls. Zwei ältere Frauen mit Kopftüchern, ein schmaler Mann mit zerfurchtem Gesicht, ein stämmiger Junger und ein dicker Glatzkopf. Am anderen Ende saßen zwei Wachleute in Uniform und unterhielten sich leise.
„Hallo zusammen“, sagte Dahlberg. „Kriminalhauptkommissar Dahlberg, LKA Berlin. Das ist meine Kollegin Kriminalhauptkommissarin Gerlinger.“
Er griff sich einen Stuhl und setzte sich rittlings darauf. Claudia nahm neben ihm Platz. Sie sah zwischen den beiden Gruppen hin und her.
„Hat jemand die Explosion mitbekommen? Muss ziemlich laut gewesen sein.“
„Dit könn’se laut sagen“, berlinerte einer der Securityleute, der einen goldenen Ohrring trug.
„Um wieviel Uhr war das?“
„So gegen vier Uhr früh.“ Dahlberg wandte sich dem Reinigungsteam zu.
„Wann beginnen Sie, hier sauberzumachen?“
„Um vier“, antwortete der Dicke, der der Chef zu sein schien. Zufall oder Zusammenhang, dachte Dahlberg. Könnte einer aus der Putztruppe ein Motiv gehabt haben, den Chefchemiker umzubringen? Hatten diese Leute das Wissen und den Mumm, so eine Sache zu inszenieren?
Er musterte die Kopftuchfrauen, die scheu auf die Tischplatte starrten, genau wie der ältere Mann. Der junge Kräftige blickte eher ängstlich drein, was nicht zu ihm passte, aber sonstwas bedeuten konnte. Der Dicke zeigte auf ihn.
„Der da, Milo, der war gerade auf der Etage, zum Glück am anderen Ende.“
„Der Kollege kann sicher für sich selbst sprechen“, sagte Claudia.
„Kann er nicht“, meinte der Glatzkopf. „Der hat nicht mal Ihre Frage verstanden. Ist gerade aus Bulgarien gekommen.“
Die Reinigungsbrigade erschien Dahlberg wenig ergiebig. Trotzdem würden sie der Firma einen Besuch abstatten und den jeweiligen Hintergrund der Angestellten checken.
„Okay, Sie und Ihre Leute können gehen. Der uniformierte Kollege draußen nimmt Ihre Personalien auf.“
Die Saubermänner und -frauen verschwanden.
„Und ab wann hatten Sie Dienst?“, wandte Claudia sich an die Wachschützer.
„Ab dreiundzwanzich Uhr. Um zweie war nur noch Doktor Winkler da. Alle anderen waren ausjetragen. Hab ihm durch die Scheibe noch zujewunken. Da hat’s schon janz schön jeblubbert.“
„War er allein?“
„Klar, wie immer nachts.“
„Ist das normal, nachts allein zu experimentieren?“
„Eijentlich nich, aber als Chefchemiker darf der dit.“
„Sie haben also niemanden gesehen außer Doktor Winkler?“
„Nein, und an uns kommt keiner ungesehen vorbei“, antwortete jetzt der andere Mann auf Hochdeutsch. „Und alle zwei Stunden macht einer von uns einen Rundgang durch alle Gebäude.“
„Das Firmengelände grenzt doch an die Spree. Könnte von dort jemand hereinkommen?“
„Das hätten wir gemerkt. Das Ufer gehen wir auch regelmäßig ab. Außerdem ist da keine Anlegemöglichkeit.“
„Wenn Sie doch mal eine Runde ausgelassen hätten, würden Sie uns das doch sagen, nicht wahr?“
„Würden wir, haben wir aber nicht.“ „Das wär’s für’s Erste“, sagte Dahlberg. „Bitte ebenfalls die Personalien hinterlassen.
“
Die Männer entfernten sich in wiegendem Bodybuilder-Gang. Eine achtköpfige Gruppe in weißen Kitteln trudelte ein, die Häupter mit einer Art Duschhaube bedeckt, darunter eine Asiatin, die wie eine Abiturientin wirkte.
„Sie sind die Kollegen von Doktor Winkler, wenn ich das richtig sehe“, empfing Dahlberg die weiße Wolke. Die Hauben nickten und nahmen nacheinander in einer Reihe Platz. Sie schienen nicht sehr erschüttert zu sein.
„Doktor Winkler hat also nachts allein Experimente durchgeführt“, begann Dahlberg. „Das haben uns die Wachleute gesagt. Und dass das normalerweise nicht üblich ist.“
„Ist es auch nicht, normalerweise arbeiten wir in Teams“, sagte ein älterer Gesetzter, dessen Kittel über dem Bauch spannte. „Aber seit einer Weile hatte der Doktor Narrenfreiheit.“
„Warum das?“
„Er hat eine neue Formel synthetisiert und patentieren lassen, die der Firma viel Geld einbringen dürfte.“
„Der Durchbruch auf dem internationalen Anti-Cellulite-Markt“, warf die Asiatin ein.
„Winkler war also ein hervorragender Chemiker und Forscher“, machte Claudia weiter. „Und wie war er als Vorgesetzter?“
„Zuarbeiten konnte er gut verteilen“, ertönte eine schneidende Stimme. Sie gehörte einem Herrn, der zumindest von der Haube abwärts elegant wirkte. Über dem Kittel sahen ein gestreifter Hemdkragen und ein perfekter Krawattenknoten hervor.
„Zum Beispiel die Testreihen auf uns abwälzen. Er war nicht wirklich teamfähig, Punkt“, schloss der Schneidige entschieden.
Dahlberg konnte ihn sich gut als neuen Chef vorstellen. Steckte hier ein Motiv, wenn es denn Mord gewesen war? Die Nachfolge auf solche Weise zu beschleunigen, kam heutzutage zwar nicht mehr oft vor. Aber nicht oft hieß nicht nie. Er betrachtete den Mann. Aber würde ein Täter seine Abneigung so deutlich zeigen? Natürlich, antwortete er sich selbst. Alles andere würde die Kollegen stutzig machen.
„Und Sie sind wer?“
„Doktor Schlecht“, antwortete er. „Stellvertretender Forschungsleiter.“ Doktor Schlecht kam auf Dahlbergs innere Liste, falls es sich nicht um einen Unfall handelte.
„Tja“, sagte ein Mitarbeiter, dessen Zopf unter der Kopfbedeckung hervorlugte. „Mit Ratten ist er besser klargekommen.“
Das war ja richtig gehässig, dachte Dahlberg.
„Und der Kollege und Mensch Gerald Winkler?“, fragte er.
„Ziemlich verklemmt“, sagte die junge Frau „Obwohl er eigentlich ganz gut aussah.“
„Echt jetzt?“ Der bezopfte Nachbar lehnte den Oberkörper zurück und sah sie an wie ein Alien. „Ist nicht dein Ernst?“
„Ja doch. Außerdem ist er seit einer Weile anders gewesen, irgendwie gelöster.“
„Kollegen, bitte.“ Ein Älterer beugte sich vor und sah die Reihe entlang, was ihn wegen des Bauches etwas Mühe kostete.
„Etwas Pietät, wenn ich bitten darf.“
„Danke.“ Dahlberg holte Luft. „Und weiß jemand, warum Winkler neuerdings gelöster war, wie die Kollegin meint?“
„Wegen des Cellulite-Patents?“, schnarrte der Krawattenträger. „Das ist doch eine Lizenz zum Gelddrucken, wenn der Jugendwahn weiter anhält. Und das wird er.“
„Okay, noch mal zurück zu den nächtlichen Experimenten. Wenn dieses Celludings schon patentiert ist, dann hat er also an etwas Neuem gearbeitet.“
„Schön geschlussfolgert.“ Wieder der Schicke mit der scharfen Stimme.

Gabriel Troost saß an seinem Schreibtisch. Die Kriminalisten würden gleich eintreffen, hatte seine Sekretärin mitgeteilt. Sein Blick verlor sich auf der matt schimmernden Platte aus Wurzelholz, Muster wie quellende Wolken oder urzeitliche Muschelablagerungen. Manche sahen auch wie Fettgrübchen aus, aber da spielte Freud ihm wohl einen Streich. Er drehte sich auf dem Stuhl um die eigene Achse und hatte die Weltkarte vor sich. In Berlin steckte eine große rote Nadel, mittelgroße verteilten sich über Europa, Russland, beide Amerikas und Südostasien. Jeweils eine kleine ragte aus Saudi-Arabien, Kuwait und Qatar, die neuen Märkte im Nahen Osten, besonders für das neue Produkt, Cellulite war bei reichen Ehefrauen ein Thema.
Von der Baustelle hinter den Kleingärten drang Baggerlärm. Gabriel Troost stand auf und trat ans Fenster. Die Aussicht war trostlos. Über den Spreearm zogen Nebelschwaden. Der Plänterwald war voller schmutzigbrauner Bäume, die Uferkante grau, die Spree wie Blei. Leicht würde das nicht werden ohne Winkler, dachte er. Zuerst musste geklärt werden, wer das Patent erbte, denn der Produktschutz galt nur für zwei Jahre. Wahrscheinlich war die Mutter die Alleinerbin. Verheiratet war der Mann nicht, kein Wunder, so verdruckst wie der Typ war. Das hatte sich erst in letzter Zeit geändert, auch kein Wunder.
Ein Schubschiff pflügte durch die Nebelschwaden über dem Wasser. Nur die Positionslichter brachten ein wenig Farbe ins Bild. Am gegenüber liegenden Ufer war ein Angler auszumachen, reglos, geduldig. Er würde der Polizei jedenfalls nicht aufs Butterbrot schmieren, dass er Winkler nicht leiden konnte. Der Angler bewegte sich, lehnte sich zurück, kurbelte wie wild und schaffte es, den Fang aus dem Wasser zu ziehen. Trotz des Dunstes konnte man den Fischleib aufblitzen sehen.


Die Gegend wirkte, als sei die Zeit stehengeblieben. In den Achtzigern oder sogar in den Siebzigern, ein Handwerker neben dem anderen, Gas-Wasser-Scheiße, Fliesenleger, Elektriker, Tischler. Ein Schaufenster voller aufgeplusterter Kissen und dilettantisch drapierter Decken warb für BETTENWERNER. Der Name stand auf einem einfachen Blatt Papier und war von innen gegen die Scheibe geklebt. Daneben eine Kneipe mit einem Schild an einer Eisenstange: UNFILTRIERT WIRD NICHT SERVIERT, noch so ein Überbleibsel. In der Seitenstraße, in der sich der Wohnort von Mutter und Sohn befand, bestimmten Vorgärten hinter schmiedeeisernen Gittern, in denen Hortensien und andere Schattenpflanzen gerade ihr Leben beendeten, das Bild. Vor der Adresse angekommen, musterte Claudia das Klingelschild aus verstaubtem Plastik, suchte den Namen und drückte den ehemals weißen Knopf, erster Stock links.
„Ja? Wer ist da?“, fragte eine hohe weibliche Stimme.
„Die Polizei, würden Sie uns bitte hereinlassen?“
Ein Schnarren ertönte, sie betraten das Treppenhaus, das nach Sauberkeit und Pflichtbewusstsein roch, und stiegen die schwarz-weiß gesprenkelte Terazzotreppe empor. Im dritten Stock, hinter vorgelegter Kette spähte ihnen ein breites, rötliches Gesicht entgegen.
„Was gibt es denn?“
Sie zeigten ihre Ausweise und stellten sich vor.
Die Kette scharrte, die Wohnungstür öffnete sich. Frau Winkler stand vor ihnen, die fleischigen Arme vor der Blusenbrust verschränkt, sie musste um die achtzig sein, der Sohn also ein spätes Kind.
„Vielleicht gehen wir erst einmal rein und setzen uns“, sagte Dahlberg.
Ohne etwas zu sagen, rieb die Frau sich die nackten Oberarme und ging vor ihnen her ins Wohnzimmer. Dahlberg registrierte eine Couchgarnitur mit Gobelinbezug und Kordelumrahmung und eine Schrankwand, in der Sammeltassen die Hauptrolle spielten. Sie setzten sich nebeneinander auf das Sofa, Winklers Mutter sank ächzend in einen der Sessel.
„Es gab eine Explosion im Labor“, begann er vorsichtig.
Frau Winkler sah ihn erschrocken an.
„Ist Gerald verletzt?“
„Ja“, antwortete er und blickte hilfesuchend zu Claudia, man wusste nie, wie Angehörige reagierten. Er hatte schon alles erlebt, von scheinbarer Teilnahmslosigkeit und seltsamen Übersprunghandlungen wie plötzlicher Putzsucht bis zu Schreikrämpfen und Ohnmachtsanfällen. Und niemals sollten die Kinder vor den Eltern sterben. Die Frau zog den Ausschnitt krampfhaft vor der Brust zusammen. „Ist … ist es schlimm?“
„Es tut uns so leid“, sagte Claudia. „Ihr Sohn ist bei dem Unglück ums Leben gekommen.“
Winklers Mutter erstarrte. Wie bei einer Magenkolik beugte sie sich vor, kam wieder hoch, wieder vor, wieder hoch und gab keinen Laut von sich. So ging es eine Weile. Dahlberg sah die ganze Zeit zu Boden, er konnte mit dem Schmerz von Hinterbliebenen noch nie gut umgehen. Ohne hinzusehen kramte Frau Winkler ein Taschentuch aus der Sesselritze und stopfte es wieder zurück. Danach begann sie, mit dem Oberkörper von rechts nach links zu schwenken, wie man es von Bären im Zoo kennt. Claudia stand auf, kniete sich neben sie und nahm ihre Hände. Das Schaukeln kam zum Stillstand und ein fast unmenschlicher Schrei durchschnitt die Luft, die sich mit Trauer und Ausweglosigkeit gefüllt zu haben schien.
Dahlberg gab Claudia ein Zeichen. Sie ließ Frau Winklers Hände los, die jetzt unaufhörlich zitterten. „Frau Winkler?“ Dahlberg beugte sich zu ihr hinunter.
„Frau Winkler, hören Sie mich?“ Die Frau sah ihn an, ohne ihn anzusehen, Tränen liefen aus den aufgerissenen Augen. „Fühlen Sie sich in der Lage, einige Fragen beantworten?“
Sie nickte mechanisch.
„Wissen Sie, ob Ihr Sohn Streit mit jemandem hatte?“
„Warum … warum fragen Sie das?“, fragte sie. Dann schüttelte sie den Kopf. „Nicht mein Gerald.“
Sie wusste offenbar nichts von den Reibereien in der Firma.
„Wie ist es mit Freunden oder Freundinnen?“
Wieder Kopfschütteln.
„Könnten wir uns bei Ihrem Sohn umsehen?“
Nicken. Sieglinde Winkler versuchte aufzustehen, schaffte es aber nicht. Dahlberg half der alten Frau aus dem Sessel. An der Garderobe drückte sie ihm wortlos einen Schlüssel in die Hand und zeigte noch oben.
Die Wohnung ihres Sohnes befand sich eine Etage höher. Schon im Flur roch es sehr sauber. Auch das Wohnzimmer glänzte. Die Schrankwand mit dem eingepassten Flachbildfernseher sah teuer aus. Genau wie die graue Couch mit silbrig schimmernden Kissen und der Tisch, auf dem silberne Leuchter standen. Der Teppich war dick und einfarbig rot, eine Farbe, die sich in den Glasschirmen der Lampen wiederholte. Dahlberg kam sich vor wie in einer Musterwohnung. Er öffnete die Schranktüren. Die Fächer enthielten VHS-Kassetten und DVDs, ordentlich aufgereiht und ordentlich beschriftet. Es waren Mitschnitte von Wissenschaftssendungen.
In einem anderen Raum, der nach Arbeitszimmer aussah, hingen Rollbilder mit chemischen Formeln an den Wänden. In einem Regal stand neben Fachliteratur eine Batterie Glaskolben, der Größe nach geordnet wie Orgelpfeifen, was seltsam humoristisch wirkte.
Der Schreibtisch war bis auf Computer und Drucker leer. Dahlberg zog den Rollcontainer darunter hervor. Die Schubkästen waren mit Kabeln, Steckern und Büromaterial gefüllt.
In der untersten Lade befand sich eine verschlossene Stahlkassette. Claudia zückte ihr Besteck und öffnete sie. Unter anderem enthielt sie eine Festplatte, hoffentlich die mit den Forschungsdaten. Dahlberg steckte sie ein und sah sich weiter um. Nirgendwo fand sich etwas Persönliches, keine Fotos oder Andenken, Winklers eigentliches Zuhause war wohl das Labor gewesen.
„Den Computer sollen die Kollegen später abholen. Jetzt noch das Schlafzimmer und das Bad. Dann sind wir durch.“
Beide waren ebenfalls exquisit ausgestattet, aufgeräumt, blitzsauber und ohne persönliche Note.
„Ganz schön heimlich, unser Toter“, sagte Claudia, als sie sich von Winklers Mutter verabschiedet hatten und wieder im Wagen saßen. „Wahrscheinlich hat seine Mutter da sauber gemacht und er hat deswegen nichts rumliegen lassen.“
„Apropos Mutter und Sohn“, murmelte Dahlberg. „Heute ist Vatergroßeinkauftag. Kannst du die Reinigungsfirma übernehmen? Wir treffen uns dann bei Herrmännsche.“

Es war acht Uhr. Niesel stäubte aus dem Morgenhimmel. Kielbaum zog ein Putztuch aus der Manteltasche, nahm die Brille ab und rieb vorsichtig die Gläser trocken, eine Herausforderung für seine breiten Hände, vielleicht sollte er doch auf ein robusteres Gestell umsteigen. Aber das dachte er jedesmal und änderte doch nichts, er mochte die Irritation, die seine Gegenüber erfasste, wenn sie seine enorme Gestalt mit dem zierlichen Exemplar – eine goldgefasste Schubertbrille mit winzigen ovalen Gläsern – in Einklang zu bringen suchten.
Er wartete auf Alexander Taub, sie hatten sich im Invalidenpark hinter der neuen Zentrale verabredet. Er war zum ersten
Mal hier, seit dem Umzug von Pullach nach Berlin. Der Park entpuppte sich als mäßig große Freifläche, mittendrin eine Art Rampe, von der Wasser in ein flaches Bassin floss. Eine Messingtafel gab Auskunft, dass der sogenannte Park einen Preis für hervorragende Landschaftsgestaltung bekommen hatte. Rampe, Beckenumrandung, Bodenplatten waren aus dem gleichen hell schimmernden Stein. Die äußerst sparsam aufgereihten Bäumchen waren Ginko, wie ein Schild ihn belehrte, seltsame Landschaftsgestaltung.
Alexander Taub kam aus Richtung Hauptbahnhof. Der kahle Kopf glänzte feucht, die Barthaare waren schon ordentlich gewachsen, bald würden sie eine altrussische Länge haben. Ein Schal verdeckte die Tätowierungen.
„Tut’s noch weh?“ Kielbaum deutete auf Taubs Hals. Keine Antwort.
Der Typ mochte ihn nicht besonders und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Aber der aktuelle Einsatz würde wahrscheinlich nicht lange dauern, es war hoffentlich ihr letzter direkter Kontakt. Die Eigenständigkeit im Außendienst mit der Lizenz zur Eigenmächtigkeit verwechseln, hatte man ja gesehen, wohin das führt, nämlich dahin, entführt zu werden. Er merkte, dass er sich schon wieder aufregte. Ohne Rücksprache und Rückendeckung eine Fahrt in die Salzwüste mitmachen. Wenn er an die Aufregung dachte, als der GPS-Tracker kurz vor der Oase Siwa den Geist auf-, beziehungsweise kein Signal mehr von sich gab. Sie mussten Taub natürlich auslösen, die russische Regierung bezahlte Lösegeld nur für ihren Botschaftsattaché. Für Taub blechte die deutsche Regierung, womit seine Legende im Eimer war.
„Gehen wir ein Stück“, sagte er trotz allem verbindlich, als der Mann vor ihm stand. Sie schlenderten den neuen Uferweg entlang. Auf der anderen Seite des Kanals stand ein helles Gebäude. Lilafarbene Fahnen hingen schlapp über den beiden eckigen Türmen.
„Wissen Sie, was das da drüben ist?“
„Museum Hamburger Bahnhof“, lautete Taubs Auskunft. Komischer Name für ein Museum, dachte Kielbaum.
Sie passierten ein niedriges Gittertor. Dahinter sah es eher nach Park aus, war aber wohl ein ehemaliger Friedhof, verwitterte Grabsteine und angerostete Kreuze unter hohen Bäumen, die schwarz vor Nässe in matschig-gelbem Gras standen. Er zog einige zusammengefaltete DIN-A4-Blätter aus der Brusttasche.
„Das Allerneueste, Schreibmaschine statt Computer.“ Er reichte Taub die Papiere. „Ihre neue Legende. Lesen, lernen, vernichten.“ „Zu Befehl, Genosse Führungsoffizier. Lesen, lernen, vernichten.“
Wollte der ihn verscheißern? Naja, man würde ja sehen, wie es diesmal lief. Taub steckte die Papiere weg. Dann ging er mit gesenkten Kopf neben ihm her, die Ellbogen angewinkelt, die Hände tief in die Seitentaschen der dunkelblauen Jacke gebohrt.
Kielbaum hätte liebend gern auf den unsicheren Kantonisten verzichtet. Aber Meier hatte in den oberen Etagen alle Bedenken ausgeräumt. Im Gegenteil, in höchsten Tönen hatte er sich über Taubs unbezahlbare und unentbehrliche Fähigkeiten ausgelassen. Und leider Gottes hatte er Recht. Es gab im ganzen BND niemanden, der Russisch wie seine Muttersprache sprach und zugleich Arabisch.

Claudia stand vor der Passage in Lichtenberg und studierte die vorgefertigte Schilderwand an der glänzenden Steinfassade. Es gab drei Mieter. Einen Computervertrieb, die Brandenburgische Bäckerinnung und die Reinigungsfirma. Sechs weitere Flächen waren leer. Claudia kannte mittlerweile einige dieser Nachwendegeburten an Büroneubauten. Es gab sie überall im ehemaligen Berliner Osten und viele erwachten nur ganz langsam zum Leben. PICOBELLO residierte im zweiten Stock des Vorderhauses, in den Räumen sah es nicht so aus. Schon im Eingang stapelten sich eingerissene Packungen, aus denen Lappen und Gummihandschuhe quollen. In den Ecken standen fusselige Mopps und Besen mit abgearbeiteten Borsten. Dafür war der Inhaber in Schale und gut vorbereitet.
„Bitte sehr“, sagte er nach der gegenseitigen Vorstellung und wies schwungvoll auf fünf kleine Stapel, die nebeneinander auf einem niedrigen, runden Tisch lagen. Claudia setzte sich und ging die Bewerbungsschreiben, Lebensläufe, Arbeitsverträge und Vertraulichkeitsvereinbarungen durch. Da war nichts, das Verdacht erweckte. Der Truppführer und der schmächtige Ältere waren schon zwanzig Jahre dabei. Die beiden türkischen Frauen konnten kaum deutsch. Und der Bulgare Milo Meschdunarodschki, der erst seit einem Monat angestellt war, offensichtlich gar nicht. Es könnte natürlich sein, dass das nicht stimmte, dass ihn eine interessierte Seite in die Putztruppe geschmuggelt hatte, um an das Opfer heranzukommen, was zuerst einem ausländischen Spionagedienst zuzutrauen wäre.
Claudia verabschiedete sich und verließ das trostlose Gebäude.
Sie lief Richtung S-Bahn Frankfurter Allee, vorbei an einem Kirchlein, wie extra aufgestellt zwischen zwei Fahrspuren, wie zur Erinnerung an alte Zeiten. Danach passierte sie das rote Rathaus Lichtenberg und eine Grünanlage mit einem runden Brunnen, über dessen schlierigem Grund sich der Regen der letzten Tage sammelte. Am Ringcenter, das wie ein Schiffsbug in die Kreuzung ragte, kamen Claudia ein paar Mädels entgegen, die den gesamten Bürgersteig einnahmen und sich auf einen bestimmten Look geeinigt zu haben schienen, taillierte Steppwesten, interessant gemusterte Strickhosen und neonstrahlende Turnschuhe. Die Haare so straff nach hinten gezurrt, dass es schon beim Hinsehen wehtat, sollte wohl irgendwie elegant wirken. An den Händen, die Zigaretten hielten, blitzten lange, schreiend bunte Fingernägel. Claudia trat beiseite, um das Geschwader vorbeizulassen.

Die Ausdrucke mit Winklers Telefondaten unterm Arm, stieg Jo von Gotthaus vorsichtig die feuchten Stufen zum Kellerlokal hinunter, deren Kanten von hundertjährigem Gebrauch rundgeschliffen waren. Er musste den Kopf einziehen, um nicht an den Türsturz zu stoßen. Die Stammkneipe war gut gefüllt, Stimmengesumm wie in einem Bienenstock. Manchmal kam ihm der Laden mit seiner niedrigen verräucherten Decke wie ein Versteck vor, in dem Jäger sich auf die Jagd vorbereiteten, was ja irgendwie stimmte. Das Mobiliar hatte sich, seit er beim LKA war, nicht verändert. Nur die Messingstange, die den Tresen umgab, wurde immer glänzender. Dafür dunkelten die Fotos von Ernst Gennat, dem ersten wirklichen Kriminalisten Berlins, weiter vor sich hin. Aber man konnte seinen ungeheurem Körperumfang noch erkennen. Das ist der volle Ernst, auch Buddha genannt, hatte Claudia gesagt, als Jo zum ersten Mal hier unten war. Der Kneipenwirt versuchte gerade, den Glasturm für Soleier vom Tresen zu heben.
„Was, keine Soleier mehr?“, hörte Jo Dahlbergs Stimme von der Treppe.
„Willscht’s letzte?“, rief der Hesse, der so hieß wie sein Laden, vielmehr so genannt wurde, nämlich Herrmännsche.
„Nee, danke, nicht mein Fall.“
„Sischst, deschwege, koa Nachfrag. Kann vielleicht mal jemand helfe von dene Herrschafte“, maulte Herrmännsche.
„Sonscht steh ich morsche noch hier.“
Dahlberg ging zum Tresen und umarmte den Glaszylinder mit der milchigen Flüssigkeit, in der ein einsames Ei umhertrieb.
„Was jetzt, wohin mit dem Ding?“
„Eifach kippe, in de Spüle. Das Zeusch muss naus.“
Ein heftiges Plätschern zeigte an, dass der Behälter in ausreichender Schräglage war. Dahlberg griff in den Ausguss und hielt ein bläulichweißes Ei hoch. „Von euch jemand?“
Claudia, die schon am Stammtisch saß, schüttelte sich. Jo ließ den Packen Papier neben sie fallen.
„Die Telefondaten. Ein Haufen Verbindungen mit 00-Nummern, USA, Japan, Großbritannien.“
Dahlberg kam an den Tisch, stützte sich mit einer Hand darauf, mit der anderen blätterte er in den Ausdrucken.
„Kein Wunder. Der Mann war eine Kapazität und stand bestimmt mit anderen Kapazitäten in Austausch.“
„Könnte aber auch heißen, dass er sich beruflich verändern und die Firma verlassen wollte“, meinte Claudia. „Wenn man bedenkt, wie toll ihn die Kollegen leiden konnten. Dann hätte er seine Forschungen mitgenommen. Und die Firma ein Motiv, das zu verhindern.“
„Aber dafür ihren besten Mann umbringen?“, wandte Jo zweifelnd ein.
„Ich weiß auch nicht“, unterstützte Dahlberg ihn. „Sieht eher nach Industriespionage aus. Ist denn in Lichtenberg was rausgekommen?“
„Nicht viel. Die einzige Möglichkeit sehe ich bei dem Bulgaren, Milo Meschdunarodschki. Da bräuchten wir einen Hintergrundcheck der dortigen Kollegen.“
„Okay“, sagte Dahlberg und stand auf. „Leiert das schon mal an. Ich muss jetzt mit den Einkäufen nach Hause.“
„Also ich wette, die Chinesen haben einen Schlangenmenschen durch die Lüftungsschächte geschickt“, flüsterte Jo laut, als Dahlberg gegangen war. Er verschränkte die langen Arme hinter dem Kopf und setzte ein verträumtes Gesicht auf. „So einen Fachmann für spurloses Auf- und Abtauchen und Scherbenwerfen.“

Die Straßenlaternen warfen scharf abgegrenzte Lichtstreifen auf den dunklen Boden. Der Stahlrahmen, der die Schieferplatte des Esstisches hielt, glänzte matt. Gabriel Troost saß im Halbdunkel. Er legte die Füße auf den Tisch, der Automatiksessel gab nach und der Bauch drückte nicht mehr so. Die Kripo hatte also eine externe Festplatte gefunden. Hoffentlich konnten die anderen Mitarbeiter etwas mit Winklers neuesten Experimenten anfangen. Aber jetzt rief erst einmal eine unangenehme Pflicht, er musste Manfred Arnheim informieren. Troost gab sich einen Ruck, schwang nach vorn und griff nach dem Handy. Nach ein paar Mal Klingeln ging sein Kompagnon ran. Troost räusperte sich.
„Es hat in der Nacht eine Explosion im Labor gegeben.“
Am anderen Ende herrschte einen Moment lang Schweigen.
„Wie groß ist der Schaden?“
„Sehr groß. Winkler ist tot.“ Troost hörte, wie sich Manfred ein Stöhnen entrang.
„Und das ist noch nicht alles“, fuhr er fort. „Der Laptop ist verschwunden.“
Jetzt kam ein Schrei durch die Leitung. „Scheiße, Scheiße, Scheiße.“
Troost nahm das Handy vom Ohr. Er konnte Arnheims Tirade auch so hören. Gabriel hätte Winkler nicht gestatten dürfen, allein zu experimentieren. Und dass er die Trennung seines Laptops vom Firmennetzwerk erlaubt hatte, sei auch ein Fehler gewesen. Natürlich seiner. Dabei hatte Manfred zugestimmt. Dann kehrte Ruhe ein. Troost nahm das Gerät wieder hoch.
„Was für eine Scheiße“, hörte er Manfred bellen. „Ein Glück, dass die Formel schon im Patentamt liegt. Da kann man Plagiate wenigstens vor den Kadi zerren.“
Troost schwieg.
„Was ist denn los? Haben sie dir die Wörter geklaut?“, tönte die gereizte Stimme weiter.
„Sei doch froh“, gab Troost zurück. „Sonst quatsch ich dir doch immer zu viel.“
„Jedenfalls gehst du nach dem ersten Schock zur Mutter und kondolierst in unser aller Namen. Und dann schwatzt du ihr das Patent ab, das ist doch deine Spezialität.“
„Zu Befehl!“
„Hör auf damit, verdammt nochmal.“
Sie legten auf. Gabriel Troost erhob sich und trat an das Sideboard, auf dem der Whisky stand, er brauchte jetzt einen oder zwei. Er musste runterkommen, abschalten, an etwas anderes denken. Mit dem achtzig Jahre alten Malt im Glas ging er Richtung Arbeitszimmer. Müde und schwer ließ er sich vor dem Computer nieder, drückte die Entertaste und nahm einen winzigen Schluck. Der Bildschirm ploppte auf und das Startbild erschien, eine Weltkugel, die sich in einem Erlenmeyerkolben drehte. Arschloch, dachte Troost wütend. Ohne ihn wäre ARNHEIM CHEMIE baden gegangen. Als er Anfang der Neunziger dazu stieß, stand die Klitsche im Schwäbischen kurz vor der Insolvenz. Und er war die Rettung. Kurz vor der Wende hatte er an der Leipziger Fakultät für Chemie und Mineralogie seine Diplomarbeit verteidigt. ‚Zum Verhältnis von Grundlagenforschung und Produktentwicklung in der Entwickelten Sozialistischen Gesellschaft am Beispiel der Kosmetikindustrie der Deutschen
Demokratischen Republik.‘ Entwickelte Gesellschaft, Troost gab einen höhnischen Laut von sich, Sprachkosmetik für ein bankrottes Land. Jedenfalls war er an alles herangekommen, was im Hochschullabor so lief, und hatte fleißig Unterlagen kopiert. Zu der Zeit kümmerte sich kaum jemand um Chemie und was man damit machen konnte. Oder nur dafür dafür, dass sie stank. Die Stadt stand kopf, alle Welt demonstrierte und diskutierte. Sinnloserweise, denn der Weg lag offen vor allen, die sehen wollten. Er wollte. Er hatte sich umgesehen und Manfred Arnheim kennengelernt, der gerade sein Betriebswirtschaftsstudium beendet hatte. Ohne ihn wär der längst weg vom Fenster, dachte Troost. Oder würde gerade noch Melkfett und Antischuppenpuder herstellen.

Manfred Arnheim schlich die Predigergasse entlang Richtung Limmat. Der Turm der Fraumünsterkirche über der Stadt war angestrahlt, er stach spitz und grün in den Zürcher Nachthimmel.
Was für ein Desaster, dachte er. Gerade noch tolle Abschlüsse gemacht, und jetzt das. Mögliche Patentverletzungen waren das Eine. Da konnte man wenigstens vor dem Europäischen Patentgericht klagen. Etwas Anderes waren Winklers neueste Forschungsergebnisse. Auch wenn er die Festplatte tausendmal kopiert hatte, niemand, auch nicht Doktor Schlecht, würde so einfach daran anknüpfen können. Niedergeschlagen sah er in die Fluten der Limmat, die unter dem alten Rathaus hindurchströmten. Der Fluss der Generationen, dachte er plötzlich. Was du ererbt bla bla bla. Wenn sie ihn nur gelassen hätten. Eine gefühlte Ewigkeit aber hatte er im Schatten des Vaters, des Großvaters, des Urgroßvaters gestanden. Auch das erfolgreich abgeschlossene BWL-Studium änderte daran nichts. Zu der Zeit
befand sich ARNHEIM CHEMIE schon eine Weile im Sturzflug, natürlich unbemerkt vom Aufsichtsrat, der aus verdienstvollen Herren höheren Alters bestand. Erst als Gabriel in Unterhausen auftauchte, seine Ideen und seine Unterlagen mitbrachte, die Altherrenriege so sehr betörte und beeindruckte, dass sie ihn machen ließen, erst da kam er zum Zuge, bei den Altvorderen und bei Frauen. Wie hieß die Polin nochmal, die er hier kennengelernt oder vielmehr, die Gabriel ihm zugeführt hatte? Egal, jedenfalls hatte sie ihm bei hundertfünfzig auf der Autobahn einen geblasen, eine Premiere. Und dank Gabriel war auch der Abwärtstrend der Firma gestoppt.
Was hatten sie alles durchgestanden in den Anfangsjahren in Unterhausen, dachte Manfred Arnheim, Produkte längst untergegangener Firmen aus der Versenkung geholt und unter neuem Namen reaktiviert, Rezepte für diverse Hausmittel aufgespürt und auf einem dankbaren Markt eingeführt, unter wohlwollendem Beifall der durchgrünten Öffentlichkeit. Und Fachleute abgeworben, darin war Gabriel unschlagbar.
Er überquerte die Münsterbrücke und tauchte in die Gassen der Altstadt ein. Vor dem Schaufenster seines Lieblingsantiquitätenhändlers blieb er stehen, die Frau Gattin hatte bald Geburtstag. Die Auslage bestand aus einem einzigen Stück. Die antike Uhr aus schwarzem Marmor war gekrönt von einer bronzenen Figurengruppe, eine Frau, die einen Schwan zwischen den Beinen hatte. Vogel vögelt Frau, dachte Arnheim, sehr schön. Er drückte die Türklinke herunter. Ein silberhelles Glöckchen ertönte. Und noch einmal, als er die Tür schloss. Das Geschäft strahlte so viel samtene Ruhe aus wie nur ging. Der Besitzer kam mit einem wissenden Lächeln hinter einer Portiere hervor, er hatte also etwas im Angebot. Arnheims Frau Beate sammelte Erotica, insbesondere japanische Netsuke, Elfenbeinschnitzereien, die klein und schmeichelnd in der Hand lagen, sehr explizit, sehr alt und sehr teuer. Er hatte keine Ahnung, wie
Beate auf diese Leidenschaft verfallen war, sexuelles Interesse konnte es nicht sein. Da war Vanessa ein anderes Kaliber.
Den historischen Fick hübsch verpackt in der Manteltasche, trat Manfred Arnheim hinaus auf die Gasse mit den kleinen, feinen Geschäften. Vom Zürichsee wehte plötzlich ein kalter Wind. Er wickelte den Schal enger um den Hals, knöpfte den Mantel zu und wandte sich Richtung Bürkli-Terrasse. Den Ruheplatz am See, mit Bänken unter Weidenbäumen besuchte er jedesmal, wenn er in der Stadt war. Eine Gruppe Schwäne strebte vom Ufer weg und verschwand in den Dunstschwaden, die übers Wasser zogen.
Normalerweise würde er die Abschlüsse mit Champagner begießen. Doch nach diesem niederschmetternden Ereignis war ihm nicht danach. Außerdem hatte Vanessa abgesagt, per Textnachricht. Arnheim wollte sich gerade auf eine Bank setzen, da ertönte das Pling einer SMS. Wieder eine Nachricht von Vanessa. Sie schrieb, sie wolle Gabriel verlassen und erwarte, dass er sich zu ihr bekenne und von seiner Frau trenne.
Manfred Arnheim wurde es heiß. Dann kalt. Sein Herz raste und schien in der Kehle zu sitzen. War die jetzt völlig verrückt geworden?

Dahlberg fand einen Parkplatz vor der chinesischen Änderungsschneiderei an der Ecke, in der es außerdem Näh-, Elektro- und Haushaltsbedarf, Perlonschürzen, Glitzer-T-Shirts und Acrylpullover gab. Seit sie dort auch Schuhe und Taschen verkauften, roch es selbst vor der Tür chemisch. Es gibt eben Chemie und Chemie, dachte er. Sie hatten es mit der Edelvariante zu tun. Schon dieser Name, JUNGBRUNNEN. Wie auch immer, wahrscheinlich würden sich damit die Spezialisten für kriminelle Wirtschaftsgebaren herumschlagen.
Er holte die Einkaufstüten mit Windeln und Babynahrung aus dem Kofferraum und machte sich auf den Weg. Das BAKLAVA hatte natürlich noch geöffnet. Cem Datoglu saß an einem der Tische, die er trotz der zunehmenden Kühle jeden Tag rausstellte, rauchte und las im Licht, das aus dem Laden fiel, Zeitung. Drinnen bediente seine Frau Sibel.
Dahlberg machte oft an dem türkischen Bäckereicafé Station. In letzter Zeit sogar noch öfter, immer, wenn er die Heimkehr an den heimischen Herd hinauszögern wollte. Dann plauderten sie bei Kaffee und Zigarette über dies und jenes. Das Wetter, die Wohnungsnot, obwohl gebaut wurde, als wenn es kein Morgen gäbe, den Lehrermangel, der sogar das Gymnasium seiner Tochter erreicht hatte. Aber Cems Lieblingsthema waren die Leute, die ihm das Jobcenter schickte und die nach kürzester Zeit wieder verschwanden. Die einen hatten Rücken, die anderen konnten nicht den ganzen Tag stehen, wieder andere waren nicht bereit, am Samstag zu arbeiten und einige erschienen gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch. Cem stemmte den Laden mit Hilfe seiner Frau Sibel. Viel Schlaf kriegten die beiden nicht, denn das BAKLAVA hatte von sechs bis vierundzwanzig Uhr geöffnet. Und Sibel ging in dem bisschen Freizeit auch noch ins Fitnessstudio, das gleiche, das Marthe seit einem Monat besuchte. Sie hatten dort Kinderbetreuung ab einem Jahr. Manchmal half auch die Tochter im Café aus. Den Sohn hatte Dahlberg noch nie gesehen. Einmal hatte er gefragt, was er mache. Cem hatte nur gesagt: ‚Weiß nicht.‘ Und Dahlberg sich gefragt, ob der Sohn nicht wisse, was er machen soll oder Cem nicht wusste, was sein Sohn machte. Eine Nachfrage hatte er sich verkniffen. Offensichtlich war das eine Wunde und er wollte nicht darin herumstochern.
Trotz der Einkäufe, oder gerade wegen, hatte er auch heute Lust auf einen Plausch und eine Zigarette.
„Tach Cem“, sagte er, lud die Last ab und setzte sich.
„Tach“, erwiderte Cem die Begrüßung ungewohnt knapp und ließ die Zeitung sinken, er schien nicht die beste Laune zu haben. Dahlberg steckte sich eine Kippe an.
„Was ist los?“, fragte er. „Wieder keine Aushilfe bekommen?“ Cem antwortete nicht, sondern tippte nur auf die aufgeschlagene Seite
, er wirkte empört.
„Wissen Sie, was hier steht?“, fragte er rhetorisch, denn er hatte den Artikel offensichtlich gelesen und antwortete sich auch gleich selbst. „Hier steht.“ Er schlug erst mit der flachen Hand auf die Zeitung und nahm sie dann hoch. „Hier steht“, sagte er in dem Akzent, den besonders die türkischstämmigen Männer lange beibehielten. „Hier steht“, las er vor, „dass es nicht tolerierbar ist, wenn Migranten nach Jahren in Deutschland kein Deutsch sprechen.“
Worüber regte Cem sich auf, fragte Dahlberg sich, er sprach doch ziemlich gut.
„Aber das betrifft Sie doch gar nicht“, sagte er. „Von Sibel und Ihrer Tochter ganz zu schweigen.“
„Aber meine Eltern. Also die sollten nach der Rackerei auch noch Deutsch lernen. Nach zwölf Stunden sind die halbtot ins Bett gefallen.“
Einerseits verstand Dahlberg Cems Aufregung, sein Vater hatte Anfang der Siebziger als Ungelernter bei Siemens am Band gearbeitet und die Mutter in der gleichen Firma die Büros geputzt. Da war nicht viel Kraft übrig geblieben. Andererseits wusste er, dass Kinder und sogar Enkel der früheren Gastarbeiter Probleme mit der Sprache hatten, sie wurden sogar größer. Das hatte er bei seinen Einsätzen als Streifenpolizist oft genug erlebt.
„Ich glaube nicht“, sagte er, „dass deren Generation gemeint ist.“
„Egal“, beharrte Cem. „Das ist nicht richtig, das ist kein Respekt.“
Wieso fing Cem jetzt auch noch mit diesem Pochen auf Respekt an, dachte Dahlberg. Ausgerechnet ihm gegenüber. Er könnte ihn ja mal fragen, wie es mit dem Respekt Polizisten gegenüber stand.
„Wollen Sie einen Espresso?“, fragte Cem in einem versöhnlichen Ton, eigentlich war ihm ja klar, dass er mit seiner Beschwerde bei Dahlberg an der falschen Adresse war. Dahlberg nickte, obwohl er vorgehabt hatte, nach der Zigarette zu gehen. Cem stand auf und rief Sibel durch die Ladentür die Bestellung zu. Lachend und nach draußen winkend setzte sie die Profimaschine in Gang. Zwei Minuten später stand die kleine Tasse vor Dahlberg. Sie steckten sich beide noch eine an und betrachteten schweigend dien Feierabendverkehr, der über das Kopfsteinpflaster polterte. Cem schien sich langsam zu beruhigen. Grinsend musterte er die Einkaufsbeutel, eine Packung Windeln sah heraus. Dahlberg hob mit einem ironisch ergebenen Gesichtsausdruck die Schultern – was soll man machen als braver Ehemann und Vater.
„Ab nach Hause“, sagte Cem Datoglu.
Dahlberg wandte sich heimwärts. Das Blau des Hauses, in dem sie seit zwei Jahren wohnten, leuchtete beim Näherkommen, sogar in der Dämmerung. Kriegt man ja Augenkrebs von, hatte kürzlich ein Taxifahrer den Fassadenanstrich kommentiert. Dahlberg gefiel er. Er schloss das rot gestrichene Tor auf und betrat die Durchfahrt. Der Kinderwagen stand unter der Treppe. Marthe und Karlchen waren also zu Hause. Eigentlich wäre er jetzt gern allein, würde es aber nicht sein. Das, was sie eigentlich nicht gewollt hatten, worüber sie sich eigentlich einig gewesen waren, keine Kinder, den Kindern zuliebe, das war jetzt Alltag. Er war Vater, ein später Vater, ein Vater mit einer Last auf den Schultern, was kleine Kinder anging. Vor der Wohnungstür angekommen, rüstete Dahlberg sich für den Ansturm der Kleinfamilie und schloss auf. Wider Erwarten war es still. Er
zog Jacke und Schuhe aus, stellte die Einkäufe ab und schlich auf Socken ins Wohnzimmer. Marthe saß auf der Couch und las. Karlchen war also schon im Bett.
„Na, Schmittchen Schleicher“, sagte sie und legte das Buch weg.
„Wie geht es Karlchen?“, fragte Dahlberg.
„Ist grad eingeschlafen, halb so schlimm, bisschen Husten. Wird man sich dran gewöhnen müssen, Bronchitis, Mandelentzündung, gebrochene Arme, Pubertät.“
Diese Sorgen, dachte Dahlberg, vielleicht verstand man Eltern erst wirklich, wenn man selber in der Lage war. Er und sein Bruder hatten ihren jedenfalls einige beschert. Einmal hatten sie die Zeit vergessen, waren gedankenverloren durch den Stadtpark getrottet, die Augen auf den Boden gerichtet, sie fanden immer etwas Interessantes. Vater wartete hinter der Tür, die Ohrfeige war so stark, dass er gegen die Garderobe flog und das Bürstenset herunter fegte. Dietrich, der Kleine, blieb verschont.
Dahlberg setzte sich neben Marthe, sie platzierte ihre nackten Füße neben seine und zwickte ihn in den Spann, sie konnte so etwas, mit den Zehen zwicken. Sie konnte auch mit den Ohren wackeln und hervorragend schielen. Und dabei kichern, wie jetzt wieder.
„Wir hatten es heute mit einer Laborexplosion zu tun“, sagte Dahlberg. „Das reinste Scherbengericht. Ein Toter, ausgerechnet der leitende Chemiker. War übrigens sowas wie ein Genie. Hat ein Wundermittel gegen Cellulite entdeckt.“
„Echt jetzt? Haste ’ne Probe?“
„Nee, haste nicht nötig.“
„Noch nicht, also dafür würde ich morden.“
„Sehr witzig. War kein schöner Anblick, der Weißkittel von einer Million Glasscherben getroffen.“
Er stand auf, ging ins Schlafzimmer und zog Laufklamotten und Sportschuhe an.
„Weißt du übrigens, dass das auch eine Form von Eitelkeit ist“, sagte Marthe, als er wieder auftauchte. Sie lehnte mit verschränkten Armen an der Arbeitsplatte und musterte ihn spöttisch.
„Was denn?“
„Nicht aussehen wollen wie frisch eingekleidet bei SPORTPOINT.“
Er sah an sich herunter, an seinem zusammengewürfelten Dress. Die grauen Pantalonwaden ragten aus einer knielangen roten Fußballerhose mit weißen Seitenstreifen, die ehemals hellen Laufschuhe hatten die Farbe von Straßendreck angenommen, den Riss in dem abgeriebenen grünen Anorak hatte er selbst geflickt, mit weißem Sternzwirn.
„Ehrlich?“ Er sah Marthe mit gesenkten Kopf von unten an, die Oberlippe absichtlich gangsterhaft verzogen. „Also ich bin dann mal weg. Aber freu dich nicht zu früh, ich komme wieder.“

Jo hatte Claudia auf ein Bier zu sich eingeladen, in seine neue Bleibe in der Frankfurter Allee, unsanierter Altbau, abgeranzt und irre laut. Aber immerhin zwei Zimmer, Küche und Bad, was brauchte man mehr. Und dank zweier Gasheizkörper aus DDR-Zeiten wenigstens warm. Im Wohnzimmer machte er sich erst einmal daran, Coffee-to-go-Becher, Pizzaschachteln, Zeitschriften und Papiere zusammenzuraffen. Claudia sah ihm grinsend dabei zu. Langsam kamen die Möbel zum Vorschein, die seine Mutter ihm vor kurzem aufgedrängt hatte, ein geschwungenes Sofa, ein ovaler Tisch auf einem einzigen dicken Bein und vier Stühle mit ovalen Lehnen, Biedermeier. Sie hatten sich endlich mit der Berufswahl ihres Sohnes abgefunden. Sein Vater, ein berühmter Weimarer Herzchirurg, hatte ursprünglich gehofft, dass Jo in seine Fußstapfen trat. Er verschwand mit dem Müll in der Küche und nahm zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank. Zurück im Wohnzimmer warf er sich in das antike Couchgestell, es knarrte bedenklich.
„Keine Angst, die sind stabiler, als man denkt.“
Jo öffnete die Kronkorken mit einem Feuerzeug und reichte Claudia eine Flasche. „Meine Mutter hat drauf bestanden, dass ich das Zeug nehme. Möbel kauft man nicht, Möbel erbt man.“
Sie prosteten sich zu. Jo straffte den Oberkörper und hob theatralisch die Hand mit der Bierflasche über den Kopf.
„Ein bisschen Stil muss sein“, sang er mit krächzender Stimme. „Ein Hoch, ein Hoch auf das, was wir nicht sind.“
„Na, du tust ja alles, den ererbten Eindruck zu verwischen“, sagte Claudia und setzte sich. „Beziehungsweise zu überdecken.“ Dann strich sie über die fein gemaserte Tischplatte. „Was ist das für Holz?“
„Kirsche, glaub ich.“
„Kirschbäume hatten wir in unserer Baumschule auch. Eine Arbeit, sag ich dir. Schneiden, pfropfen, Erde lockern, sprühen, den schweren Kanister auf dem Rücken. Und das da?“ Sie zeigte auf eine Vitrine, mehrere Paar Westernstiefel hinter Glas.
„Schuhschrank.“ Jo grinste. „Meine Mutter kriegt einen Anfall.“
Er setzte die Bierflasche an und nahm ein paar große Schlucke.
„Erinnerst du dich an meine erste Wohnung im Erdgeschoss, wie klamm die im Winter war? Dafür schön kühl im Sommer. Das war aber auch der einzige Vorteil.“
Claudia nickte.
„Soko Scherbe.“ Jo lachte auf. „Da haben wir jede Abkühlung herbeigesehnt. Mann, wenn ich daran denke, Brandsachen bei sowieso schon dreiunddreißig Grad im Schatten. Wie die Feuerfans einfach nur Flaschen zerschlagen und die Scherben auf den Rasen werfen mussten. Der kein Rasen mehr war. Sondern der reinste Zunder. Und die Scherben wie Linsen.“
Er trank aus und stand auf. „Jedenfalls ist das ’ne irre Sache mit dem zerschnippelten Chemiker. Was ist denn? Ist dir schlecht?“
Claudia schüttelte den Kopf. „Aber hör auf, irgendwann ist auch mal Feierabend.“
Jo holte zwei weitere Biere aus der Küche.

Das Sprühen ging in Niesel über, Feuchtigkeit legte sich als kühler Film auf Dahlbergs Gesicht. Auf dem alten Schlachthofareal war nicht mehr viel los. Vom Supermarkt wehte das Klirren und Rattern der Transportwägelchen herüber, beladen mit den Resten des Verkaufstages, Kisten, Kartons, Folien, Flaschen. In der Dämmerung glühten Feierabendzigaretten auf, rhythmisch wie Minileuchtfeuer. Signale aus der Arbeitswelt, wenn man so wollte. Die S-Bahn fuhr in die Station Storkower Straße ein, eine leuchtende Schlange. Dahinter lag der Stadtteil Lichtenberg, eine Schallgrenze, die Dahlberg aus unerfindlichen Gründen nie überschritt. Er drehte ab Richtung Süden, er fühlte sich plötzlich einsam auf dem riesigen, dunklen Gelände. Die Eldenaer Straße kreuzte, die Bänsch, die Rigaer. An der Frankfurter Allee stand die Ampel auf Rot. Er nutzte den Stop, stützte sich gegen den Mast, um die Waden zu dehnen, und blickte in strahlende Autoreihen, die noch anonymer waren als am Tage, die Insassen verborgen, von drinnen spähend.
Im Kiez war die Hölle los, ein Treiben wie anderswo mittags um zwölf, eine Kneipe ging in die nächste über. Man hatte den Ruf aus Friedrichshain vernommen und veranstaltete hier tagtäglich und vor allem nachtnächtlich Weltjugendfest spiele. Unter den feuchten Markisen fingen sich allerlei Sprachen, die Heizpilze glühten. Dahlberg wich auf die Fahrbahn aus. Am Boxhagener Platz warfen die Lokale – echte Vietnamesen, getürkte Italiener, Shisha- und Falafelläden, Spätshops mit Bierbänken davor – ihr anheimelndes Licht auf die dunkel aufragenden Bäume in der Platzmitte. In der Nähe hatte Alexander zuletzt gewohnt, in einer WG, zusammen mit Pauline, einer Mathematikstudentin, und Halbundhalb, der schlauen Mischlingshündin, die so aussah wie sie hieß, das Gesicht samt Ohren in der Mitte geteilt, die eine Hälfte weiß, die andere schwarz.
Gruß an den ganzen Alexander und den halbierten Hund, war Marthes Spruch gewesen, wenn er Bescheid sagte, dass es wieder spät werden könnte. Dahlberg selbst war sich in seiner Anhänglichkeit oft komisch vorgekommen. Einmal hatte er Alexander ein heißes Bad eingelassen, nach einem eisigen Einsatz im Winter. Alexander wohnte damals in einer anderen Altbau-WG mit Ofenheizung. Die Mitbewohner hatten anfangs falsche Schlüsse gezogen, als er nach dem Anheizen des Badeofens auch noch heißen Tee in die schlauchartige Kammer brachte. Später gewöhnten sie sich an seine Fürsorge. Tief im Inneren wusste Dahlberg, woher die kam, Alexander war der Bruder geworden, den er verloren hatte.

